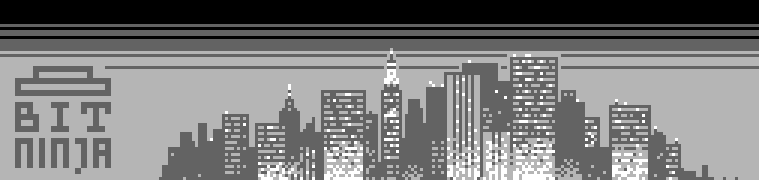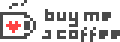XBox One Review: The Outer Wilds im Test
geschrieben am 20.02.2020
Ausgestattet mit einer neuen XBox One S und Gamepass habe ich mich aufgemacht, die Geheimnisse von the Outer Wilds zu ergründen, wurde der Titel doch von mir geschätzen Publikationen wie Giantbomb als Spiel des Jahres 2019 in den höchsten Tönen gelobt und müsste eigentlich genau meinen Geschmack treffen. Dabei stellt der öffentliche Diskurs durchaus ein zweischneidiges Schwert dar, denn einerseits ist es für eine vernünftige Besprechung des Spiels unumgänglich, auf gewisse Sachverhalte einzugehen, andererseits machen deren Entdeckungen einen erheblichen Teil des Reizes aus. Das beginnt bereits bei der Einordnung der Spielmechanik. Denn was auf den ersten Blick wie ein Space-Survival Spiel aussieht, entpuppt sich als hochgradig ausgearbeitet narratives Erlebnis: Als neuestes Mitglied des Weltraumerforschung-Programms Outer Wilds kann man nach kurzer Einleitung im heimatlichen Dorf per rustikalem Rauschiff, dass eher an einen Kreuzung aus VW Bully und Planwagen denn ein Hightechgefährt erinnert, ins All aufbrechen, wo ein kompettes Sonnensystem zur Erforschung bereitsteht. Das mutet zunächst wie eine Mammutaufgabe an, wird aber durch mehrere Umstände relativiert: zunächst einmal handelt es sich beim Outer Wilds Universum quasi um einem Miniaturkosmos, dessen Planeten und Monde oft nur wenige Kilometer Durchmesser haben und sich so zumindest oberflächlich (ha) relativ schnell untersuchen lassen. Auch die Abstände zwischen dem guten Dutzend stellarer Objekte strotzen den uns bekannten pysikalischen Gesetzen großer Objekte und sind somit teilweise wortwortlich mit nur einen kurzen Katzen- bzw. Jetpacksprung zu überbrücken.
Zudem wird ziemlich früh im Spiel klar, dass man in eine Zeitschleife festhängt, die die Forschungsreise nach maximal 22 Minuten wieder von vorne beginnen lässt. Was es damit auf sich hat und wie dieses Phänomen mit der augestorbenen auserirdischen Rasse der Nomai zusammenhängt, die im gesamten Sonnensystem Spuren wissenschaftlicher Experimente hinterlassen hat, ist eines der zentralen Mysterien, die es zu ergründen gilt. Dieses geschieht hauptsächlich, indem man teils mit dem Raumschiff, hauptsächlich aber zu Fuß, verschiedene, mitunter nicht leicht zu erreichende Orte erforscht und dort gegebenfalls alte Aufzeichnungen der Nomai per Übersetzungsscanner entziffert. Dem Zeitschleifenkonzepf geschuldet gibt es dabei keinen „Fortschritt“ im herkömmlichen Sinne eines Videospiels: Es gibt nichts „aufzuleveln“, man erlangt keine neue Fähigkeiten oder Ausrüstung, und Manipulationen an der Umgebung werden bei jedem neuen Durchlauf konsequent zurückgesetzt. Lediglich das vom Spieler auf der Reise erlangte Wissen bleibt erhalten und wird im Bordcomputer in Form einer Gerüchtekarte dauerhaft gespeichert. In bester Verschwörungstherie-Manier werden so nach und nach die verschiedenen Lokalitäten und Ereignisse stichpunktartig zusammengefasst und per Bindfaden-Netz in Verbindung gesetzt. Zudem kann hier als eine der wenigen spielerischen Erleichterungen ein Wegpunkt zu einem bereits besuchten Ort gesetzt oder nachgeprüft werden, ob es sich lohnt, diesen weiter zu erforschen. Diesbezüglich hat entwickler Mobius tatsächlich phantastische Arbeit geleistet und entspinnt nicht nur praktisch mit komplett passiven Mitteln wie Textaufzeichnungen und visueller Gestaltung eine fazinierende Science Fiction Story rund um Quantenphysik, Zeitmanipulation und große philosophische Fragen, die nicht nur einmal an Stanley Kubricks Meisterwerk 2001, Odyssee im Weltall erinnert, sondern teilt diese sozusagen als Spur aus kleinen Brotkrumen so geschickt auf, dass allerorts die Neugierde geweckt wird und sich nicht selten ebensoviele neue Fragen ergeben wie beantwortet werden. Es gibt kaum etwas befriediegenderes, als aufgrund eines Hinweises einen neuen Ort zu erforschen und dort auf ein weiteres Puzzelstück zu stoßen, dass etwas mehr Licht in eines der Mysterien bringt oder auch eine bisherige Theorie komplett auf den Kopf stellt. Wie beispielsweise in Her Story ist die Nicht-Linearität, in der sich die Ereignisse aufgrund der praktisch uneingeschränkt zugänglichen Spielwelt entfalten, dabei Fluch und Segen zugleich: Ich hatte das „Glück“, bereits bei meinen ersten Ausflügen auf mehrere der merkwürdigeren Phänomene zu stoßen, die sofort den Drang in mir weckten, ihnen auf den Grund zu gehen. Durch meine nicht an einen strikten Ablauf gebundenen Handlungsfreiheit hatte ich somit wirklich das Gefühl, selbst die Geschehnisse aktiv zu analysieren statt nur eine von den Machern erdachte Geschichte nachzuerleben. Andererseits kann das komplette Fehlern einer leitenden Struktur mitnunter auch zu Frust oder Unverständnis führen, zumal das Spiel nur sehr wenige Mechankiken wirklich erklärt: so konnte ich zwar schon in der Einführung eine Sonde und ein akustisches Ortungsgerät ausprobieren, es dauerte jedoch eine ganze Weile, bis ich begriff, dass diese Hilfsmittel auch Bestandteil meines Raumanzugs und -schiffs sind. Und selbst nach etlichen Stunden war ich mir nicht sicher, ob ich vollends die Funktionsweise der Kodec-Artefakte und anderer widerkehrender Technologien vollends verstanden habe. Die gleiche „Unschärfe“ (ha) trifft auch auf die Textaufzeichnungen zu, denn so gut diese auch geschrieben sind und auf amüsante Art die wissenschaftliche Neugierde und alltäglichen Sorgen der Nomai zum Ausdruck bringen, sind die in ihnen enthaltenen Hinweise oft unnötig wage. Es mag sein, dass ich durch die Hilfestellungen moderner Spiele zu verwöhnt oder schlichtweg zu dumm bin – vor allem da mein Studium der Quantenmechank und Astrophysik eine Weile her ist – aber ebensooft, wie ich einer konreten Spur folgte und bewusste Handlungen vornahm, die zur Klärung des „großen Ganzen“ beitrugen, hatte ich das Gefühl, praktisch zufällig über kleine Teilerfolge zu stolpern oder mir gar ziellos an einem Problem die Zähne auszubeißen. Das ganze führte sogar dazu, dass ich einen der Abspänne zu Gesicht bekam, ohne mir genau sicher zu sein, was ihn ausgelöst hat oder ob es sich gar um einen Bug handelt. Ebenso ist es möglich, das komplette Aspekte der Story schlicht übergangen werden. So habe ich von Spielern gehört, die das Spiel beendet haben und dennoch eine Struktur, die einem Tutorial der physikalischen Phänomene noch am nächsten kommt, nie entdeckt haben, weil sie eben vielleicht etwas zu gut versteckt war.
Doch Outer Wilds ist nicht nur interlektuell eine Herausforderung, auch die Steuerung verlangt einiges an Arbeit. Technisch kommt das Spiel als pysiklastige 3D Simulation daher. Das ist in Anbetracht des übergordneten Themas „Erforschung“ zwar durchaus sinnig, zumal die dynamischen Abläufe im Universum quasi einer Spieluhr gleichen, indem Planeten auf Umlaufbahnen kreisen, auseinanderbrechen oder sonst wie miteinander interagieren. Andererseits gehen mit dieser Art von Systemen auch stets eine Reihe von Problemen und „Glitches“ einher. Dabei sind weder das seltene Festhängen an der Umgebungsgemetrie noch die träge Steuerung des Raumschiffs meine Hauptkritikpunkte. In bester „Thrust“-Manier muss man sich bei den interplanetaren Reisen zwar mit Gravitation und Trägheit der Masse auseinandersetzen, jedoch ist das Gefährt (ebenfalls wie ein VW-Bus) recht robust und verzeiht zumindest leichte Unfälle. Es ist vielmehr die Fortbewegung zu Fuß, die im Zusammenspiel mit etlichen absturzgefährlichen Wegen, clippinganfälligen Gravitationsaufzügen und unnötigen Energiekristallen, die das Laufen an Wänden ermöglichen, oftmals für Frustation sorgt. Solche Elemente mögen in einem Jump-and-Run noch Kernkonzepte des Spiels sein, in Outer Wilds erscheinen sie vielmehr als willkürliche, teils sogar störende Hindernisse, die die Entfaltung einer spannenden Geschichte ausbremsen. Zu allem Überfuss wurden darüber hinaus von den Entwicklern noch Survival-Elemente wie ein knapper Sauerstoff- und Treibstoffvorrat für den Raumanzug eingeführt. Somit dürfte ich seltener das „reguläre“ Ende der Zeitschleife erlebt haben als dass mich der Tod durch Ersticken, Verglühen, zu starke Verletzungen aufgrund eines Sturzes oder eben doch einer zu haschen Landung ereilt hat oder ich zerquetscht, verstrahlt, gefressen oder schlicht ohne Aussicht auf Rettung in die Weiten des Alls geschleudert wurde.
Dabei sind vor allem die finalen Momente vor dem „Reset“ auch dank gezieltem Musikeinsatz wunscherschön melankolisch in Szene gesetzt. Denn über weite Strecken verzichtet Outer Wilds auf einen klassischen Spielesoundtrack, was dem cineastisch anmutenden Einsatz von bestimmten Melodien und Themen in Schlüsselmomenten um so mehr Gewicht und Emotionalität verleiht. Dementsprechend funktioniert die Untermalung auch eher als „Filmscore“ denn als für sich alleinestehende Songs. Der Einsatz des Banjos im Titelmenü unterstreicht beispielsweise den DIY-Charakter und die Lagerfeuer-Atmoshäre, die das Outer Wilds Projekt wie ein gefährliches Champing-Abeuenteuer anmuten lässt. Neben dem Low-Tech Design der Raumfahrt-Ausrüstung glänzen vor allem die Planeten zumindest konzeptionell mit unverbrauchten Grundideen wie dem Doppelsystem, dass eng umeinander kreist und dabei permanent Unmengen an Sand von der einen auf die andere Oberfläche fließen lässt. Technisch kommt das Spiel degagen etwas bieder daher. Vor allem die großflächig eingesetzten und sich häufig wiederholenden Texturen der nicht übermäßig detailierten außerirdischen Ruinen wirken recht schlicht und fast wie aus einem Tutorial der Unity-Engine, und zumindest auf der XBox One S kommt es gelegentlich zum Einbrechen der Framerate, wobei diese Kritikpunkte selstverständlich bei einem storygetriebenen Spiel weit weniger ins Gewicht fallen und vor allem der Größe des Indieteams geschuldet sein dürft.
Alles in Allem bin ich mit Outer Wilds trotz einiger wirklich begeisternder Momente nicht wirklich warm geworden. Zwar finde ich Story und Grundkonzept als großer Mystery-Fan weiterhin hervorragend und vielleicht sogar wegweisend für nachfolgende Projekte, doch die spielerische Verpackung hat mich – so sehr einzelne Entscheidungen auch nachvollziehbar sind – eher verschreckt und die Spielerfahrung für mich unnötig in die Länge gezogen beziehungsweise von ihren Stärken abgelenkt. So merkwürdig es klingen mag, hätte ich mir von Outer Wilds mehr Walking- und weniger Space Sim gewünscht, auch wenn dieses einige Opfer in Bezug auf das offene Spieldesign bedeutet hätte.